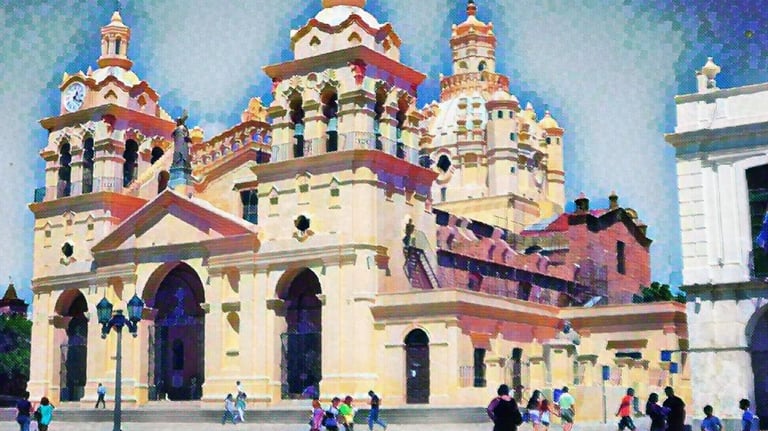Ravenna: Perle an der adriatischen küste
Entdecken Sie Ravenna, eine ruhige Perle an der Adriaküste, die Sie auf eine Zeitreise durch das römische Reich, das Ostgotenreich und das byzantinische Reich mitnimmt. Beeindruckende Bauwerke und Mosaiken erwarten Sie.
ITALIENSTÄDTE
3/12/20257 min lesen


Ravenna – eine Stadt voller Geschichte und Kunst – war einst Hauptstadt großer Reiche und ein Schmelztiegel unterschiedlicher Kulturen. In ihren Bauwerken spiegelt sich der Übergang von der römischen Antike zum christlichen Mittelalter wie in kaum einer anderen Stadt wider. Heute ist sie eine stille Perle an der Adriaküste. Wer jedoch ihre Straßen durchwandert, begibt sich auf eine Zeitreise durch das späte Römische Reich, das Ostgotenreich und das Byzantinische Reich – Epochen, die in eindrucksvollen Monumenten und Mosaiken fortleben.
Die Erinnerungen an den dramatischen Niedergang des römischen Reiches, an die Wirren der Völkerwanderung, an Alarichs Eroberungen und an die gotische Herrschaft, über der Theoderichs Gestalt noch immer zu wachen scheint – all das durchzieht die Stadt. Auch das Ende der Goten, ihre letzten Schlachten, in denen Totila und Belisar, Tejas und Narses zu heroischen Gestalten wurden, sowie die byzantinische Epoche unter den Exarchen verleihen Ravenna einen einzigartigen Zauber, der die Vorstellungskraft beflügelt.
Von der römischen Hauptstadt zur gotischen Residenz
straße in ravenna
Bild von elena magnotta auf pixabay


Auf den ersten Blick mag Ravenna unscheinbar wirken, ja fast enttäuschen. Zahlreiche Städte Italiens – selbst kleine Burgen in den Bergen – erscheinen imposanter. Doch wer sich auf die alten Stätten einlässt, spürt den Atem der Geschichte mit einer Kraft, die man andernorts kaum findet – Rom ausgenommen. Die Stadt liegt auf flachem Terrain, durchzogen von stillen Straßen, gesäumt von modernen, geradlinigen Bauten. Über ihr liegt eine Atmosphäre versunkener Träumerei, ein Hauch melancholischer Verlassenheit. Die prachtvolle Epoche des guelfischen Mittelalters, die andernorts durch Paläste und große Kirchen sichtbar ist, hat in Ravenna kaum Spuren hinterlassen. Nur vereinzelt ragen abgetragene Türme oder verlassene Paläste auf, deren Ursprung nicht weiter als ins 15. Jahrhundert zurückreicht.
Die Spuren des antiken Ravenna – einst römische Hochburg – sind fast völlig verschwunden. Classe und Cäsarea, einst blühende Vorstädte mit prächtigen Bauten, sind im Sumpf versunken, kaum ein Zeugnis erinnert an ihre Existenz. Ravenna war das Avignon der römischen Kaiser. Im Jahr 402 erhob Kaiser Honorius die Stadt zur Hauptstadt des Weströmischen Reiches. Zwei Jahre später verlegte er seine Residenz endgültig dorthin – geschützt durch Sümpfe, Lagunen und das Meer. In dieser Abgeschiedenheit fand das Reich strategischen Rückhalt in den stürmischen Zeiten der Völkerwanderung.
Honorius, ein schwacher Herrscher in einer Welt im Umbruch, erlebte aus der relativen Sicherheit Ravennas die Schmach der ersten Eroberung Roms durch Alarich im Jahr 410. Er starb 423 in Ravenna. Die wahre Erbin seines Erbes war jedoch seine Halbschwester Galla Placidia – eine der faszinierendsten Frauengestalten des späten Römischen Reiches. Als Tochter Theodosius’ des Großen wurde sie bei der Plünderung Roms verschleppt, mit dem Westgotenkönig Athaulf vermählt und kehrte nach einer dramatischen Odyssee an den Hof zurück. Nach dem Tod ihres Mannes Constantius III. und der Geburt ihres Sohnes Valentinian III. übernahm sie die Regentschaft für ihren unmündigen Sohn. Ihre Regierungszeit war geprägt von inneren Krisen und politischen Wirren. Sie starb 450 in Rom, ihr Sohn wurde 455 ermordet – mit ihm endete die theodosianische Dynastie im Westen.
Ihr Mausoleum – das berühmte Grabmal der Galla Placidia – zählt zu den erhabensten Schöpfungen frühchristlicher Kunst. Die tiefblaue Kuppel mit dem goldenen Sternenhimmel und die leuchtenden Mosaiken im Inneren machen das kleine Bauwerk zu einem symbolischen Schrein für das untergehende Imperium.
Nach Valentinians Tod versank das Weströmische Reich in Machtkämpfen. Kurzlebige Kaiser und rivalisierende Heerführer prägten die Zeit, germanische Söldner übernahmen die Kontrolle. Orestes, einst ein hoher Beamter unter Attila, erhob seinen Sohn Romulus Augustulus zum Kaiser – nur um bald darauf 476 von dem Skiren Odoaker gestürzt zu werden. Mit dessen Machtübernahme endete das weströmische Kaisertum. Odoaker herrschte fortan als König Italiens von Ravenna aus, formal dem oströmischen Kaiser untergeordnet.
Doch auch Odoakers Herrschaft war nur von kurzer Dauer. Kaiser Zenon beauftragte Theoderich, den König der Ostgoten, mit der Rückeroberung. Nach jahrelangen Kämpfen zog Theoderich 493 in Ravenna ein, nachdem er Odoaker bei einem vermeintlich versöhnlichen Bankett eigenhändig getötet hatte.
Mit Theoderich dem Großen begann eine neue, glanzvolle Epoche. Obwohl Germane und Arianer, verstand er sich als Wahrer römischer Tradition. Die Verwaltung blieb römisch, Latein die Amtssprache, und seine Berater waren gebildete Römer. Sein Ziel war ein Nebeneinander von Goten und Römern – gestützt auf Toleranz und gegenseitigen Respekt.
Das architektonische Erbe seiner Zeit prägt Ravenna bis heute: Die Palastkirche Sant’Apollinare Nuovo mit ihren prächtigen Mosaiken und das monumentale Mausoleum Theoderichs mit seinem gewaltigen Dachstein aus istrischem Kalk sind eindrucksvolle Zeugnisse. Die klare, beinahe klassizistische Formensprache dieser Bauten zeigt den bewussten Rückgriff auf das römische Erbe – Ravenna wurde zur Brücke zwischen Antike und Mittelalter, zwischen lateinischer Kultur und germanischer Herrschaft.
In dieser stillen Kulisse erheben sich zahlreiche Kirchen – oft halb verfallen, mit alten freistehenden Glockentürmen aus rohem Ziegelstein. Manche wurden restauriert, andere bewahren ihren eigentümlichen Stil aus der Zeit der Gotik. Keine ist imposant wie die Dome von Pisa, Siena oder Orvieto, doch im Innern bergen sie Mosaiken und figürliche Kompositionen von einzigartiger Schönheit – Zeugnisse einer Kunst, die nur an wenigen Orten der Welt überdauert hat. Diese uralten Kirchen wirken wie verzaubert in der Gegenwart dazustehen. Sie sind es, die die Geschichte der Vergangenheit bewahren, während die heutige Stadt Ravenna kaum mehr als ihr mit Mosaiken verziertes Grab zu sein scheint.


basilika san vitale, glockenturm
Bild von francesca m auf pixabay
Die byzantinische Eroberung und kaiserliche Pracht
Doch das Gleichgewicht währte nicht. Nach Theoderichs Tod verfiel das Reich der Goten, und 540 eroberte der oströmische Feldherr Belisar Ravenna im Auftrag Justinians. Die Stadt wurde zu einem Schlüsselzentrum byzantinischer Macht in Italien. Aus dieser Zeit stammen viele der Mosaiken, die Besucher noch heute in Staunen versetzen.
Ein Höhepunkt ist die Basilika San Vitale, deren Mosaiken Christus, Kaiser Justinian und seine Gemahlin Theodora in majestätischer Pracht zeigen. Auch Sant’Apollinare Nuovo – einst unter Theoderich errichtet – wurde byzantinisch umgestaltet und erzählt nun in Bildern vom neuen Machtanspruch.
Langobarden, Franken und das Erbe der Jahrhunderte
Die glanzvolle byzantinische Epoche Ravennas sollte nicht ewig währen. Im Jahr 751 endete die Herrschaft der oströmischen Exarchen, als die Langobarden – ein germanisches Volk, das seit dem späten 6. Jahrhundert weite Teile Italiens unter seine Kontrolle gebracht hatte – die Stadt eroberten. Der langobardische König Aistulf nahm Ravenna ein und machte damit dem letzten Bollwerk byzantinischer Macht in Norditalien ein Ende. Damit fiel auch die Funktion Ravennas als Sitz des Exarchats – jener besonderen byzantinischen Verwaltungseinheit, die politische und militärische Gewalt in sich vereinte.
Dieser Verlust war in Konstantinopel ein schwerer Schlag, doch die byzantinische Reaktion blieb aus – zu weit war die Hauptstadt entfernt, zu sehr war das Reich bereits durch äußere Bedrohungen im Osten gebunden. Das Papsttum, das bis dahin zumindest formal byzantinischer Oberhoheit unterstand, sah sich durch die Nähe der langobardischen Macht zunehmend bedroht. In dieser Not wandte sich Papst Stephan II. an den Frankenkönig Pippin den Jüngeren, den Vater Karls des Großen. Mit dem sogenannten Pippinischen Schenkung – einem folgenreichen Akt – sicherte der Franke dem Papst nicht nur militärischen Beistand zu, sondern versprach ihm auch die Rückgabe Ravennas und weiterer Gebiete. Damit wurde der Grundstein für den späteren Kirchenstaat gelegt.
Im Jahr 774, nach dem endgültigen Sieg über die Langobarden, betrat Karl der Große selbst die Bühne Ravennas. Er übernahm nicht nur den Königstitel der Langobarden, sondern ließ auch die ehemals byzantinischen Gebiete – darunter Ravenna – in das fränkische Reich eingliedern. Für den Frankenherrscher, der sich bewusst in der Nachfolge der römischen Kaiser sah, war Ravenna ein Ort von symbolischer Bedeutung: eine Stadt, in der sich die kaiserliche Machttradition mit der christlichen Kultur der Spätantike verband.
Karl der Große zeigte großes Interesse an der Kunst und Architektur Ravennas. Einige der bedeutendsten Mosaiken, insbesondere aus San Vitale, ließ er nach Aachen bringen, um seine neu entstehende Residenzstadt mit dem Glanz der alten Imperien zu schmücken. Ravennas Bildsprache und Architektur – von der strengen Ordnung der byzantinischen Mosaiken bis hin zur gewölbten Bauweise seiner Kirchen – beeinflussten maßgeblich den karolingischen Kunststil. So wurde Ravenna zur Brücke zwischen der antiken Welt und dem aufblühenden christlich-abendländischen Kaiserreich Karls des Großen.
Heute: Eine Stadt als Zeitkapsel
Obwohl die politische Rolle Ravennas in den folgenden Jahrhunderten schwand, blieb die Stadt ein kulturelles Gedächtnis Europas – ein steinernes Archiv der Reiche, die hier einst herrschten. Die Mosaiken, Mauern und Kirchen erzählen von einer Zeit, in der Imperien sich begegneten, vermischten und weiterentwickelten.
Besonders eindrucksvoll ist das Mausoleum der Galla Placidia: Mosaiken mit Sternenhimmel und biblischen Szenen zählen zu den ältesten christlichen Kunstwerken überhaupt. Sie erinnern an eine Zeit, in der Ravenna ein leuchtendes Zentrum der Spätantike war.
Ein Spaziergang durch die Stadt ist eine Begegnung mit römischen Kaisern, gotischen Königen und byzantinischen Herrschern. Ravenna verbindet auf einzigartige Weise Vergangenheit und Gegenwart – eine Einladung, auf den Spuren vergangener Imperien zu wandeln.


mosaik bild, basilika san vitale
Bild von tetedelart1855 auf pxhere
In dieser stillen Kulisse erheben sich zahlreiche Kirchen – oft halb verfallen, mit alten freistehenden Glockentürmen aus rohem Ziegelstein. Manche wurden restauriert, andere bewahren ihren eigentümlichen Stil aus der Zeit der Gotik. Keine ist imposant wie die Dome von Pisa, Siena oder Orvieto, doch im Innern bergen sie Mosaiken und figürliche Kompositionen von einzigartiger Schönheit – Zeugnisse einer Kunst, die nur an wenigen Orten der Welt überdauert hat. Diese uralten Kirchen wirken wie verzaubert in der Gegenwart dazustehen. Sie sind es, die die Geschichte der Vergangenheit bewahren, während die heutige Stadt Ravenna kaum mehr als ihr mit Mosaiken verziertes Grab zu sein scheint.


mosaik bild, basilika san vitale
Bild von tetedelart1855 auf pxhere


straße in ravenna
Bild von elena magnotta auf pixabay


basilika san vitale, glockenturm
Bild von francesca m auf pixabay
Von der römischen Hauptstadt zur gotischen Residenz
Die byzantinische Eroberung und kaiserliche Pracht
Langobarden, Franken und das Erbe der Jahrhunderte
Heute: Eine Stadt als Zeitkapsel
Ähnliche Beiträge
Iguazú-Wasserfälle - Reisebericht